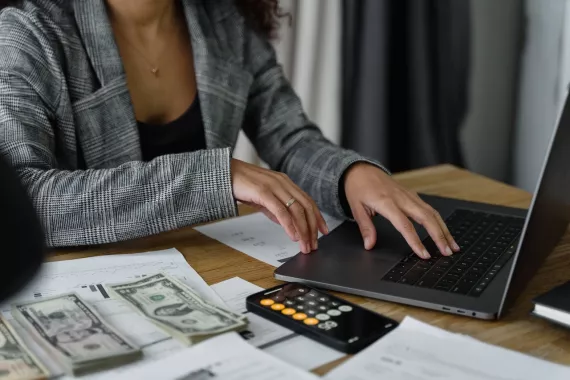Kennt ihr das: Menschen, die einen einfach in ihren Bann ziehen, weil sie diese enorme Energie ausstrahlen? So ging es mir, als ich Ondine Riesen, die Gründerin von Ting, kennengelernt habe. Einfach ansteckend und energetisierend. Ting ist ein Pionierprojekt, eine Community, die Finanzierungen anders anpackt: Mit monatlichen Beiträgen wird ein gemeinsames Vermögen aufgebaut, dass dann im Umlageverfahren allen als zeitlich begrenztes Einkommen zur Verfügung steht.

Kurz erklärt
Im weitesten Sinne geht es bei der Gemeinschaftsfinanzierung um die Bereitstellung von Geldern zusammen mit einer Gruppe von Menschen, um ein bestimmtes Ziel, Projekt oder eine Initiative zu unterstützen. Typischerweise passiert dies durch Spenden, Darlehen, Investitionen oder allenfalls Vorverkäufe. Community-basierte Finanzierungsmodelle können dabei ganz unterschiedliche Formen annehmen und sich verschiedenen Themen widmen (Mikrofinanzierung für Kleinstunternehmen, Gesundheitswesen (Community-Based Health Insurance Schemes), gemeinsam finanzierte Infrastruktur, und weitere).
Die Art des Modells im Crowd-Bereich kann zudem stark variieren, vor allem mit dem steigenden Einsatz von Technologie. Du kannst z.B. zusammen mit anderen Immobilien erwerben, dich an Unternehmen beteiligen, mit Crowd-Lending anderen Menschen Geld gegen Zinsen ausleihen und vieles mehr.
Beim Beispiels des Community-Pionierprojekts Ting geht es nicht um die Maximierung einer Rendite, sondern um das Schaffen einer zeitlich begrenzten Einkommensmöglichkeit durch Umverteilung.

Community-Geld im Umlageverfahren
Die bekanntesten Beispiele für Community-Geld im Umlageverfahren sind Sozialversicherungen. Bei der AHV finanzieren die wirtschaftlich Aktiven die Rentner:innen, indem das eingezahlte Geld zur Finanzierung der Leistungen verwendet wird.
Das gleiche Prinzip nutzt Ting (Angaben Webseite Ting):
- Die Mitglieder zahlen monatlich Beiträge auf ein Gemeinschaftskonto ein. Es gibt drei Beitragsformen: Unterstützen kannst du die Umverteilung schon ab CHF 10 monatlich. Mit einem Beitrag ab CHF 75 pro Monat kannst du bis zu zwei Monate Community-Geld beantragen, mit einem monatlichen Beitrag ab CHF 150 bis maximal sechs Monate.
- Für den Bezug des Geldes stellen die Mitglieder einen Antrag, der von Ethiker:innen anhand von vier Kriterien geprüft wird und an dem alle Community-Mitglieder (freiwillig) mitentscheiden: Dein Vorhaben soll intrinsisch motiviert sein, sich positiv auf deine Biographie auswirken, einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen und gesetzeskonform sein. Je nach Dauer und Art deiner Mitgliedschaft kannst du zwischen CHF 2’000 und CHF 2’500 pro Monat für maximal sechs Monate beziehen.
- Um für die Zukunft stabil zu bleiben hat Ting ein Rücklagekonto, von welchem auch die Verwaltungskosten beglichen werden. Da das Ziel von Ting die Investition in Menschen und Veränderung durch die Umverteilung von Geld ist, verspricht die Community auch keine monetären Gewinne oder Renditen.

Zusammengefasst ist der Gedanke hinter Ting der folgende:
«Wir glauben, dass der Mensch nicht übers Haben, sondern übers Sein glücklich wird und viel vom Sein mit der eigenen Tätigkeit zu tun hat, die als sinnhaft betrachtet wird. Wir bieten unseren Mitgliedern eine Möglichkeit dafür.»
Damit das Finanzierungsmodell reibungslos langfristig funktioniert, braucht die Community laut eigener Webseite rund 2’500 Mitglieder. Heute sind bereits über 600 Menschen dabei.
Selbstverständlich hat so ein Modell auch seine Vor- und Nachteile: Vorteile sind sicherlich, dass du dich für die Gemeinschaft engagierst und bei Bedarf eine Finanzierungsquelle für dein Vorhaben hast. Nachteile und Risiken sind für dich persönlich, wenn dein Antrag z.B. nicht gutgeheissen wird, oder das System ausgenutzt wird (kurz einzahlen, lange beziehen). Solchen Risiken versucht die Community mit entsprechenden Geschäftsbedingungen und gemeinsamen Regeln entgegenzuwirken.

Der Unterschied zum bedingungslosen Grundeinkommen
Im Gegensatz zum Modell von Ting, das als Community ein Einkommen auf Zeit durch Umverteilung zur Verfügung stellt, ist die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens ähnlich, aber nicht das Gleiche. Ein bedingungsloses Grundeinkommen geht nämlich weiter: Jede(r) Bürger:in eines Staates erhält lebenslang ein existenzsicherndes Einkommen. Für die Schweiz lag der Vorschlag für die Abstimmung 2016 bei 2’500 Franken pro Monat.
Als Vorteile eines solchen bedingungslosen Grundeinkommens werden Bekämpfung von Armut, Möglichkeit von Absicherung gegen Arbeitslosigkeit und grössere persönliche Freiheit genannt. Dem gegenüber stehen Fragen der Finanzierung, der Organisation und als häufiger Kritikpunkt die Frage, ob ein solches Grundeinkommen den Anreiz zu arbeiten reduziert oder nicht.
Es gibt bereits eine Reihe verschiedener Experimente und Feldversuche:
- Ein Experiment in Finnland an 2’000 arbeitslosen Menschen hat gezeigt, dass sich das Grundeinkommen signifikant positiv auf die Zufriedenheit und psychische Belastung auswirkte. Ebenfalls waren die Menschen mit dem Grundeinkommen eher erwerbstätig als Menschen in der Kontrollgruppe. Allerdings waren diese Unterschiede gering. Details zum Experiment findest du im Artikel von McKinsey
- Ein bekanntes langjähriges Beispiel ist der Alaska Dividend Fund. Dieser zahlt pro Einwohner:in seit 1976 ca. 1’000-2’000 US$ pro Jahr aus. Gespiesen wird der Fond durch die Öl- und Bergbaueinnahmen, errichtet wurde er als Investition für zukünftige Generationen, die nicht mehr über Öl als Ressource verfügen werden. Mehr dazu hier.

Weltweit gibt es ganz verschiedene Experimente für das bedingungslose Grundeinkommen, z.B. in Kanada, Brasilien, Deutschland, Spanien, China, Japan, Kenia. Eine Übersicht der verschiedenen Experimente zeigt dieser Artikel. Die damit erzielten Resultate sind vielfältig, von mehr Bildung bis hin zu reduziertem Stress, höherem Vertrauen und grösserem Gemeinschaftssinn. Einige der Experimente aber scheiterten auch an der Organisation oder politischen Hürden. Die Frage, ob das Grundeinkommen negative Auswirkungen auf die Arbeitstätigkeit hat, konnte bis jetzt aber nicht abschliessend beantwortet werden.
Für alle, die sich für das Thema interessieren, hier auch ein paar Bücher zum Thema: ”Basic Income: A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy“ von Philippe Van Parjis und Yannick Vanderborght, ”Give People Money: How a Universal Basic Income Would End Poverty, Revolutionize Work, and Remake the World“ von Annie Lowrey sowie ”Unconditional Freedom“ von David Casassas.
-
Wie die Superreichen ihr Geld investieren
Wir zeigen dir, wie die Superreichen ihr Geld erfolgreich investieren. -
6 Gründe, warum selbstständige Unternehmen scheitern und wie dir das nicht passiert
Wir zeigen dir, wie es ganz einfach ist, gar nicht erst in klassische Fehler bei der Unternehmensgründung zu tappen. -
10 Wege, um passives Einkommen zu erzielen
Dich entspannt zurücklegen und Geld bekommen klingt doch gut, oder? Wir verraten dir wie.